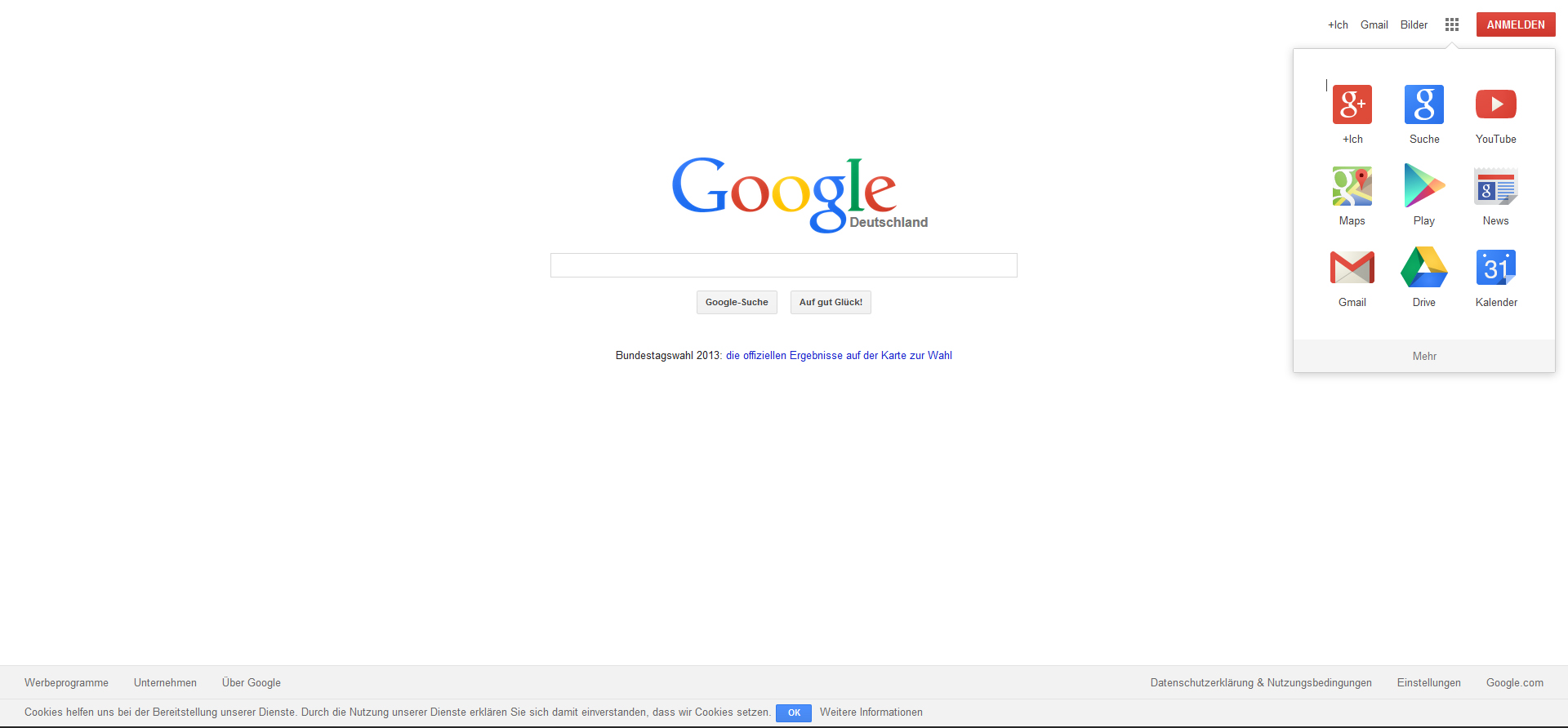Im Medienbetrieb und auch im Journalismus spielt die Personalisierung eine wichtige Rolle. Sei es in den Reportagen, Porträts, Features, Interviews oder im Fiktiven die Hauptfigur des Krimis, der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung oder der Krankenhausserie. Aber das sind alles Formen der Personalisierung, in der die Urheber und gezielt auch die Journalisten primär nicht selbst im Vordergrund stehen. Sie können es, wenn sie es möchten. Sie müssen aber nicht plötzlich die Person sein, mit der wir uns als Konsumenten identifizieren.
Das ändert sich jedoch, wenn es um die sozialen Netzwerke geht. Die These, dass die Nutzung der sozialen Netzwerke alternativlos sei, kritisiert Martin Giesler auf socialmediawatchblog.de zwar als eine Ansage von Facebook, Twitter und Co, der die deutschen Journalisten blind folgten. Fakt ist aber: Viele Journalisten, Redaktionen und Medienhäuser haben sich dazu entschlossen, soziale Medien zu nutzen. Daher ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, welche Strategien Sinn ergeben. Die sozialen Netzwerke stellen die Journalisten vor die Herausforderung, dass nun sie selbst Teil der Personalisierung sind, gerade auch bei Twitter.
Alle machen alles, weiß noch wer Bescheid?
Wir nutzen jetzt Twitter, also machen wir für die Redaktion einen Twitterkanal auf. – Dieses Vorgehen ist naheliegend. Der Account kann dann ja, je nach Lust und Laune, von den Redakteuren befüllt werden. Die Mehrarbeit hält sich in Grenzen. Damit nicht alles so anonym ist, gibt es Kürzel für die jeweiligen Redakteure. Die Nutzer können dadurch sehen, dass wir keinen Feed haben, der automatisch Twitter bespielt.
Kürzel können helfen, um den Account einer Redaktion persönlicher zu gestalten. Kürzel helfen aber nicht, wenn die Redakteure schlicht die Dachzeile oder Unterzeile und den Titel, mit einem Bindestrich getrennt, zusammen mit dem Shortlink in einen Tweet kopieren. Kürzel helfen auch nicht, wenn die Redakteure durchformalisiert nach Styleguide und ohne erkennbare Persönlichkeit dahinter – oder kunterbunt ohne Strategie dahinter – den einen Account bespielen. Entweder wird der Kanal schnell langweilig oder er ist nur unübersichtlich.
Also ist dieses Vorgehen nicht optimal, wenn die Nutzer über Persönlichkeiten zu den Inhalten gelockt werden sollen. Außerdem lässt es sich nicht gut diskutieren, wenn unklar ist, wer der Ansprechpartner ist. Als Lösungsmöglichkeit bietet sich hier an, zwei, drei Leuten die Verantwortung für den Twitteraccount der Redaktion zu übertragen. Affine Redakteure, die sowieso auf Twitter unterwegs sind. (Die Angabe „zwei, drei Leute“ steht dabei nur als Synonym für „überschaubare Anzahl“.) Damit lässt sich ein Redaktionsaccount personalisieren. Die restlichen Redakteure können sich dann auf ihre bisherige Arbeit konzentrieren. Zugleich werden dabei neue Persönlichkeiten aufgebaut und den Nutzern bekannt gemacht.
Warum neue Persönlichkeiten nutzen, wenn schon Namen für die Redaktion, das Medienhaus, den Sender stehen?
Es gibt diese Menschen bereits, die fest mit ihren Medienmarken verbunden sind. Claus Kleber und das ZDF, Heribert Prantl und die Süddeutsche Zeitung, Tom Buhrow und DasErste. Diese drei Namen sind nur einige wenige und willkürlich ausgewählte Beispiele. Nun gut, Letzterer hat sich inzwischen auch von den Tagesthemen verabschiedet. Aber müssen Chefredakteure, Redaktionsleiter und Moderatoren twittern? Kann das das Erfolgsrezept der Medien und Redaktionen sein? Sind es zu wenige, die das schon tun? Der Gedanke ist naheliegend, dass die ohnehin schon prominenten Köpfe auch auf Twitter prominent sein sollen. Natürlich hätte es seinen Reiz, wenn Kleber, Prantl und Buhrow (auch als WDR-Intendant) twittern würden. Sie sind bekannte Namen, die als Knotenpunkt auf Twitter fungieren und so auch Einfluss auf die Diskussionen und Themensettings auf Twitter nehmen könnten. Dadurch entstünde eine Eliteposition innerhalb des sozialen Netzwerkes. Ihr Einfluss und damit der der Medienmarke, für die die Journalisten stehen, würde stärker werden.
Aber: Welchen Mehrwert bringt das der Redaktion und den Nutzern? Es ist reizvoll bekannte Multiplikatoren zu haben. Ich halte es aber für interessanter und zielführender, wenn die Redakteure generell – unabhängig von Hierarchie und Bekanntheit – die Möglichkeit bekämen, ihre eigenen Twitterkanäle für die Redaktion, die Medienmarke zu betreuen. Zugleich sind dabei natürlich auch die Redakteure aufgefordert, sich auf das Abenteuer Twitter einzulassen. Ausprobieren, eigene Meinung bilden, eigenen Stil entwickeln – so werden die Redakteure, die die Arbeit in den Redaktionen machen, zu den prominenten Persönlichkeiten im Web. Die Medienmarke kann dadurch auf eine breite Bekanntheit aufbauen.
Chefredakteure, Redaktionsleiter und Moderatoren müssen aus meiner Sicht nicht zwingend twittern. Sie können es aber und sollten es ausprobieren. Sie müssen ein Verständnis für dieses Medium entwickeln und wissen, was damit möglich ist und was nicht. Die Personalisierung und das Erreichen von Nutzern gelingen Redaktionen und Medienhäusern aber auch anders. Bekommen Redakteure die Möglichkeit und die Motivation, Twitter auszuprobieren, können sie zu Markenzeichen der Redaktionen werden (z.B. @fiete_stegers für die NDR Netzwelt, @LarsWienand für die Rhein-Zeitung, @martingiesler und @Huwendiek für heute.de).
Im Netz ist für die einzelnen Nutzer nicht zwingend relevant, wer bekannt ist. Vielmehr wird in einer Reihe von Informationsmöglichkeiten die Quelle bekannt, die individuell für den einzelnen Nutzer relevant ist. Bekannte Persönlichkeiten aus Print und Rundfunk bekommen Follower wegen ihrer Bekanntheit. Die Redaktion bekommt dadurch aber nicht unbedingt eine höhere Nutzerbindung oder Klickrate für ihre Inhalte.
*Änderung: 18.06.2013, 19.50 Uhr – Ein Umbruch vor dem letzten Absatz wurde eingefügt; 20.03.2013, 11.37 Uhr – Tippfehler korrigiert.